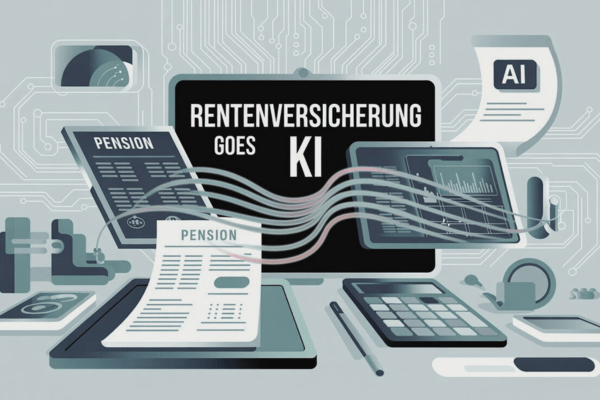Im Jahr 2022 hat Österreich eine bedeutende steuerliche Reform beschlossen, die seit 2023 in Kraft ist: die Abschaffung der kalten Progression. Diese Maßnahme zielt darauf ab, eine versteckte Steuererhöhung, die durch die Inflation entsteht, größtenteils automatisch auszugleichen. Doch was bedeutet das konkret für die Steuerzahler und welche langfristigen Auswirkungen sind zu erwarten?
🔄Was ist die kalte Progression?
Die kalte Progression tritt auf, wenn Lohnerhöhungen, die lediglich die Inflation ausgleichen sollen, dazu führen, dass man in eine höhere Steuerklasse rutscht – obwohl das reale Einkommen nicht steigt. Das Ergebnis ist eine schleichende Steuererhöhung, denn mehr vom Bruttoeinkommen wird versteuert, während die Kaufkraft des Nettoeinkommens sinkt.
🔄Kernpunkte der Reform
Um diese Ungerechtigkeit zu beseitigen, hat die österreichische Regierung einen entscheidenden Schritt unternommen: Zwei Drittel der Inflationsrate werden nun automatisch zur Anpassung der Einkommensteuertarife verwendet. Der verbleibende Teil der Inflationsrate steht im Ermessen des Finanzministers dies über weitere Entlastungen an die Bürger weiterzugeben.
Diese regelmäßige und automatisierte Anpassung der Steuertarife reduziert die Auswirkungen der kalten Progression.
🔄Finanzielle Auswirkungen der Reform
Die Reform wird bereits spürbar:
- Für das Jahr 2024 wird mit einer Inflation von 9,9% gerechnet.
- Die kalte Progression hätte ohne Gegenmaßnahmen 3,655 Milliarden Euro betragen.
- Von diesen 3,655 Milliarden Euro werden 2,471 Milliarden Euro automatisch ausgeglichen, über den Rest von 1,184 Milliarden Euro entscheidet der Finanzminister.
🔄Konkrete Maßnahmen für 2024
Für 2024 wurden mehrere konkrete Anpassungen angekündigt:
- Anhebung der Tarifstufen: Je nach Einkommensstufe werden die Steuerstufen um 7,3% bis 9,6% angehoben.
- Erhöhung von Absetzbeträgen: Absetzbeträge, wie der Alleinverdienerabsetzbetrag, werden zu 100% an die Inflation angepasst.
- Überstundenbegünstigung: Der monatliche Überstundenfreibetrag steigt von 86 Euro auf 120 Euro. 2024 und 2025 gibt es sogar eine temporäre Erhöhung auf 200 Euro.
- Familienförderungen: Der Kindermehrbetrag und der steuerfreie Arbeitgeberzuschuss zur Kinderbetreuung werden erhöht.
🔄Langfristige Auswirkungen
Die Reform ist nicht nur kurzfristig von Bedeutung, sondern auch auf lange Sicht: Ohne die Abschaffung der kalten Progression hätte der Staat bis 2025 zusätzliche Einnahmen von über 10 Milliarden Euro verzeichnet. Stattdessen wird durch die Anpassung der Steuertarife vor allem Arbeitnehmern, Pensionisten und Familien geholfen, ihre Kaufkraft zu erhalten.
🔄Fazit
Mit der Abschaffung der kalten Progression geht Österreich einen wichtigen und innovativen Schritt in Richtung steuerlicher Fairness. Diese Reform schützt die Bürger vor versteckten Steuererhöhungen und sorgt dafür, dass Lohnerhöhungen nicht zu einem realen Kaufkraftverlust führen.
Für diese innovative, automatisierte und in der EU einzigartige Steuerentlastungsstrategie hat der österreichische Finanzminister Brunner vom deutschen Finanzminister Lindner den Mittelstandspreis 2023 erhalten! Deutschland kann hier von Österreich viel lernen!
📌Mehr zum Thema Lohnabrechnung Österreich erfahren? Webinar Grundlagen der Lohnabrechnung Österreich – Unterschiede zu Deutschland in 1 Tag! buchen!